bildquelle: IMAGO: Ursula von der Leyen, Friede Springer und Liz Mohn beim Empfang im Journalisten Club der Festveranstaltung
anlaesslich des 100. Geburtstages von Axel Springer in der Axel-Springer-Passage im Springer Haus in Berlin | Langsam: Mein Blog ist mein Kartenraum und keine Bühne. Ich weiss wie man publiziert. Das hier ist etwas anderes. d!a!n!k!e | WORK IN PROGRESS reload für aktuellen schreibstand | warum ich nicht publiziere? weil ich es kann. weil es geht. weil ich es für angemessen halte.

die ganze playlist auf WikiDienstag.ch | abonniere kostenlos den WhatsApp-channel #LavinaNera treis
Anlass zu diesem Eintrag:
zwei der mächtigsten frauen der gegenwart in deutschland sind:
Hier die Abschluss-Tabelle: „Feminismus: Friede Springer vs. Liz Mohn“
| Person | Startposition | Aufstieg durch | Machtbasis heute | Feministische Lesart |
|---|---|---|---|---|
| Friede Springer | Sekretärin im Verlag | Ehe mit Axel Springer (4. Ehe) | Großaktionärin, Haupterbin Axel Springer SE | Beispiel für Aufstieg über patriarchale Strukturen, kein eigener Feminismus |
| Liz Mohn | Telefonistin/Assistentin | Ehe mit Reinhard Mohn (2. Ehe) | Führung in Bertelsmann-Stiftung, Einfluss im Konzern | Symbol dafür, wie Frauen über „dienende Rollen“ Zugang zur Macht fanden, aber patriarchale Logik reproduzieren |
- „Feminismus“ hier nicht als Emanzipation, sondern als paradoxes Muster: Frauen erlangen Macht – aber nur über patriarchale Kanäle.
Summary
Das Desaster des Feminismus zeigt sich exemplarisch an Friede Springer und Liz Mohn. Frauen, die nicht durch Emanzipation, sondern durch Anpassung an patriarchale Strukturen an die Spitze gelangten. Ihre Karrieren belegen: Geschlecht diente lange als wirksamstes Mittel sozialer Kontrolle.
Heute sitzen sie mit Ursula von der Leyen in einer Reihe – Frauen für den Krieg. Sie verkörpern, wie weibliche Macht in den bestehenden Ordnungen nicht Befreiung bedeutet, sondern die Kontinuität von Herrschaft: Militär, Medien, Kapital.
Doch diese Ordnung zerfällt. Biologie ist technisch überschreibbar, Sprache entlarvt sich als vernebelnd, Identität wird plural gelebt. Geschlecht verliert damit seine disziplinierende Kraft – und Macht sucht neue Instrumente: Daten, Plattformen, Biopolitik, Algorithmen und Narrative.
wie misogyn ist dieser eintrag?
Der Vorwurf „misogyn“ kommt schnell, sobald Frauen als Akteurinnen von Herrschaft kritisiert werden.
- Trennung
- „Ich kritisiere nicht Frauen, sondern Machtstrukturen, die durch Frauen genauso reproduziert werden wie durch Männer.“
- Umkehrung
- „Emanzipation heißt nicht Schonung, sondern Verantwortung – auch Frauen in Machtpositionen müssen Kritik aushalten.“
- Einordnung
- „Misogyn wäre, Frauen pauschal abzuwerten. Ich zeige im Gegenteil: sie sind Teil des Spiels um Herrschaft und Krieg – nicht Opfer, sondern Mitspielerinnen.“
Misogyn ist, wer Frauen die Fähigkeit zur Verantwortung abspricht.
@sms2sms
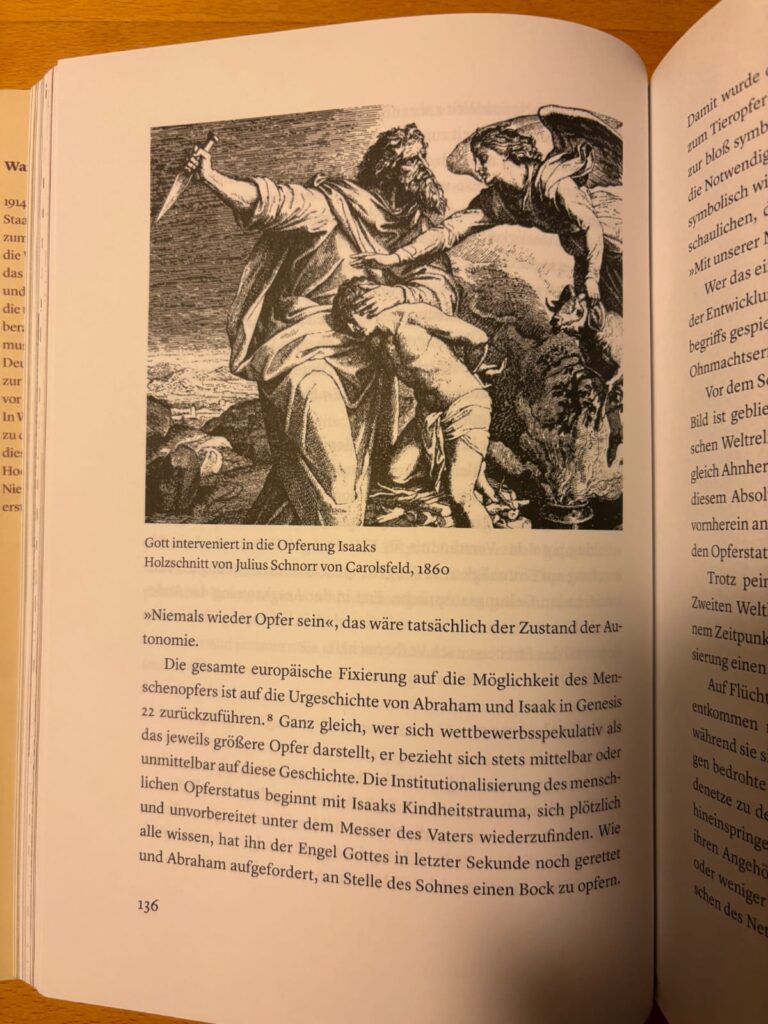
Ja, genau – Bazon Brock bindet das Konzept von Autonomie an die radikale Formel:
„Niemals wieder Opfer sein.“
Kontext:
- Ursprung in der biblischen Erzählung von Abraham und Isaak (Genesis 22).
- Europa baut seine Opferlogik auf diesem Mythos auf – die Bereitschaft, das größte Opfer zu bringen.
- Autonomie entsteht erst, wenn man aus dieser Logik aussteigt.
- Autonom ist nicht, wer Opfer bringt – sondern wer sich weigert, Opfer zu sein.
Kurzformel nach Brock:
- Autonomie = radikale Absage an die Opferrolle.
Hier die 3‑Punkte-Erklärung „Opfer – Macht – Autonomie“ nach Brock:
- Opfer
- Europäische Geschichte gründet auf der Logik des größten Opfers (Abraham/Isaak).
- Wer Opfer bringt, sichert Anerkennung – aber bleibt gebunden.
- Macht
- Herrschaftssysteme verlangen immer neue Opfer (Krieg, Arbeit, Gehorsam).
- Die Opferrolle stabilisiert Macht, weil sie Unterordnung erzwingt.
- Autonomie
- Autonomie beginnt dort, wo man das Opfer verweigert.
- „Niemals wieder Opfer sein“ = radikale Selbstbestimmung jenseits der Opferlogik.
#feminismus | geschlecht als mittel der sozialen kontrolle
– das zieht die Linie von Friede Springer / Liz Mohn bis zu heutigen Inszenierungen.
Zu deinem Gedanken:
- Ja, heute sieht man ein Muster: Frauen werden auffällig oft an „hässlichste Positionen“ gesetzt – als Verteidigungsministerinnen, Frontfiguren für unpopuläre Reformen, Aushängeschilder in Krisen.
- Effekt: Kritik trifft „die Frau“ (und wird leicht als Misogynie abgetan), während die eigentlichen Machtstrukturen unsichtbar bleiben.
- Besonders beliebt: junge, „frische“ Frauen – sie wirken modern, sauber, unverdorben, und eignen sich daher perfekt als Projektionsflächen für Herrschaftsstrategien.
Kurzformel:
- Früher: Frau = Opferrolle.
- Heute: Frau = Schutzschild für unpopuläre Macht.
Hier eine Liste typischer Rollen, in denen das Muster sichtbar wird:
- Politik
- Verteidigungsministerin = „Frau für den Krieg“ (z. B. in Deutschland, Frankreich, auch in der EU).
- Junge Ministerinnen für „Digitales“ oder „Familie“ = Aushängeschilder für Themen, die man marginalisieren oder „weich“ rahmen will.
- Wirtschaft
- Frauen als Vorstände von Krisenkonzernen (Banken, Airlines, Tech), oft wenn ein Unternehmen bereits schwer angeschlagen ist.
- Symbol: „Gläserne Klippe“ – Frauen steigen in Führungspositionen auf, wenn das Risiko des Scheiterns besonders hoch ist.
- Medien
- Junge Moderatorinnen als „Frischgesicht“ für harte Propaganda oder Boulevard.
- Weibliche „Opinion Leader“, die Themen rahmen, die in männlicher Stimme aggressiver wirken würden.
- Internationale Organisationen
- Frauen als Frontfiguren für humanitäre Narrative (UNO, EU), während im Hintergrund knallharte Machtpolitik läuft.
Kurzformel:
- Gläserne Decke war gestern.
- Gläserne Klippe ist heute.
Das erinnert an Alice Schwarzer vs. Esther Vilar… aber davon später mehr ;-)
„Eine kurze Geschichte der Geschlechterfrage“
Verstanden – dann ergibt sich eine andere Struktur: „Geschichte der Geschlechterfrage als Antworten auf die Soziale Frage“
- Antike (ca. 1000 v. Chr. – 500 n. Chr.)
- Soziale Frage: Ordnung von Haus und Polis.
- Antwort: Patriarchat – Frau auf Familie reduziert, Mann im öffentlichen Raum.
- Mittelalter (500‑1500)
- Soziale Frage: Wie Teilhabe in ständischer Ordnung sichern?
- Antwort: Klöster als Räume für Frauen → Bildung & geistliche Autorität als Nischenlösung.
- Reformation & Frühe Neuzeit (1500–1800)
- Soziale Frage: Wer bestimmt über Glauben & Ordnung?
- Antwort: Frauen zurück ins Haus – Klöster weg, Ehe als Pflicht, weibliche Teilhabe massiv beschnitten.
- Moderne (19.–20. Jh.)
- Soziale Frage: Arbeiterrechte, Demokratie, Gleichheit.
- Antwort: Frauenbewegung – Recht auf Bildung, Arbeit, politisches Stimmrecht.
- Gegenwart (21. Jh.)
- Soziale Frage: Wie umgehen mit Vielfalt, Technologie, Biopolitik?
- Antwort: Dekonstruktion von Geschlecht, Gender-Debatten, neue Kämpfe um Inklusion.
Kurzformel: Jede Epoche bearbeitet die Geschlechterfrage als Spiegel der sozialen Frage.

- (—) Mittelalter
- Geschlechterfrage = göttlich festgelegte Ständeordnung.
- Frau eingebunden in Haus & Ehe, Ausnahmen nur im Kloster.
- (+) Antike
- Geschlechterfrage = Ordnung von Haus & Polis.
- Frau primär für Familie, Mann für Öffentlichkeit; punktuelle Ausnahmen (Priesterinnen, Philosophinnen).
- (≠) Moderne
- Geschlechterfrage = Gleichstellung in Staat & Recht.
- Frauenbewegung fordert Rechte; binäre Logik bleibt Grundlage.
- (#) Nächste Kulturform
- Geschlechterfrage = Inklusion jenseits von Patriarchat & Emanzipation.
- Geschlecht als offenes Spektrum, Care & Commons als soziale Basis.
Kurzformel:
- Antike (+): Ordnung
- Mittelalter (—): Ständeordnung
- Moderne (≠): Gleichstellung
- Nächste (#): Inklusion
Die Soziale Frage
Hier die Vergleichstabelle „Teilen & Herrschen – früher vs. heute“:
| Epoche | Mittel zum Teilen | Wirkung auf die Masse | Nutzen für die Eliten |
|---|---|---|---|
| Antike | Religion, Ethnie, Stadtstaat | Loyalität an Kult/Polis, Spaltung von Völkern | Kaiserreiche sichern Macht |
| Mittelalter | Kirche, Häresien, Ständeordnung | Streit über Glaubensfragen, Standeskämpfe | Feudalherren behalten Land & Abgaben |
| Neuzeit | Nation, Konfession, Ideologien | Kriege, Patriotismus, konfessionelle Fronten | Monarchien & Staaten stabilisieren sich |
| Moderne (20. Jh.) | Klasse, Rasse, Ideologie (links/rechts) | Polarisierung, Weltkriege, Kalter Krieg | Kapital & Staaten konsolidieren Macht |
| Gegenwart | Identität (Gender, Sprache, Kultur) | Kulturkämpfe, symbolische Grabenkämpfe | Ökonomische Machtkonzentration schreitet fort |
darum hat sich die geschlechterdebatte bis heute als mittel der sozialen kontrolle geeignet. und warum das heute nicht mehr geht (so?)
Ja, genau – so lässt es sich pointieren:
- Bis heute
- Geschlechterdebatten dienten der sozialen Kontrolle:
- Antike: Polisordnung (Mann öffentlich, Frau privat).
- Mittelalter: Kirche (Ehe, Haus, Kind).
- Moderne: Staat (Familienrecht, Arbeitsrecht, Frauenbewegung als kontrollierte Inklusion).
- Geschlechterdebatten dienten der sozialen Kontrolle:
- Warum es heute nicht mehr geht
- Biologie ist technisch überschreibbar (IVF, Hormone, Gentech).
- Sprache entlarvt sich als kontingent (jede Grammatik anders).
- Identität wird individuell gewählt und plural gelebt, nicht mehr kollektiv zuordnungsfähig.
- Konsequenz
- Die Geschlechterdebatte taugt nicht mehr als Herrschaftsinstrument.
- Sie zerfällt in individuelle Identitätsfragen – und verliert damit ihre frühere disziplinierende Kraft.
Kurzformel:
- Früher: Geschlecht = Kontrolle.
- Heute: Geschlecht = Kontingenz.
Hier die Übersicht:
| Gestern: Geschlechterdebatte als Kontrolle | Heute: Geschlechterdebatte als Kontingenz |
|---|---|
| Biologie = unverrückbar (Mann/Frau) | Biologie = technisch überschreibbar |
| Sprache = Norm (generisches Maskulinum etc.) | Sprache = plural, widersprüchlich, dekonstruiert |
| Rolle = festgelegt (Haus, Ehe, Arbeitsteilung) | Rolle = fluide, selbstgewählt, vielfältig |
| Macht = Disziplinierung durch Kirche, Staat, Patriarchat | Macht = verliert Zugriff, Identität nicht kollektiv steuerbar |
| Geschlechterordnung = Herrschaftsinstrument | Geschlechterfrage = individuelle Aushandlung |
Geschlecht war lange das wirksamste Mittel sozialer Kontrolle – heute zerfällt es in Kontingenz, und Macht muss sich neue Instrumente suchen.
Hier die neuen Instrumente sozialer Kontrolle (nach dem Zerfall der Geschlechterordnung):
- Daten
- Tracking, Überwachung, Scoring (Social Credit, Konsumprofile).
- Plattformen
- Digitale Gatekeeper (Google, Meta, Amazon), die Zugang zu Kommunikation und Märkten kontrollieren.
- Biopolitik
- Gesundheit, Reproduktion, Lebensführung als regulierbare Sektoren (Impfpässe, IVF, Gen-Screening).
- Algorithmen
- Unsichtbare Steuerung durch Empfehlungen, Rankings, Nudging.
- Narrative
- Identitätspolitik, Kulturkämpfe, Spaltungsdiskurse als Ablenkung.
Kurzformel:
- Früher: Geschlecht.
- Heute: Daten + Plattformen.
(…)
(…)
(…)
(…)
Sex als mittel der fortpflanzung — bist du ver-rückt?
Hier eine knappe 4‑Punkte-Analyse:
- Früher
- Sex = einziger Weg zur Fortpflanzung.
- Gesellschaftlich „seriös“, religiös eingebettet, moralisch abgesichert.
- Heute
- Medizinische Technik (IVF, Pränataldiagnostik, Gen-Screening) bietet Alternativen.
- „Gesunde Kinder“ werden eher geplant als „gezeugt“.
- Wahrnehmung
- Sex wirkt zunehmend „unseriös“ als Mittel der Fortpflanzung: zufällig, riskant, voller Unsicherheiten.
- Technik dagegen gilt als planbar, optimierbar, sicherer.
- Ambivalenz
- Sex bleibt emotional, identitär, lustvoll.
- Fortpflanzung wird in die Labore verschoben – biopolitisch kontrolliert, kommerzialisiert.
Kurzformel:
- Sex = Lust.
- Kinder = Technik.
Sex ist heute Spiel – wer Kinder will, geht ins Labor.
@sms2sms
SPRCHE — DNKN — WRKLCHKT
Sehr guter Punkt – hier die Argumentationslinie:
- Sprache = Rahmen
- Jede Sprache legt mit ihren Artikeln, Genus-Systemen und Wortfeldern schon Vorentscheidungen fest.
- Beispiel: Deutsch → „die Sonne“ (feminin), „der Mond“ (maskulin). Italienisch → „il sole“ (maskulin), „la luna“ (feminin).
- Denken = geformt durch Sprache
- Sprachliche Kategorien strukturieren Wahrnehmung und Vorstellung.
- Gleichstellung stößt an unsichtbare Grenzen, weil die Sprache selbst Differenz produziert.
- Wirklichkeit = gespiegelt durch Sprache
- Geschlecht wird nicht nur beschrieben, sondern hergestellt.
- Eine „geschlechterneutrale“ Sprache ist Illusion, weil jede Grammatik neue Asymmetrien aufbaut.
- Konsequenz
- Vollkommene Gleichstellung ist in der Sprache nicht erreichbar.
- Sprache kann bestenfalls sichtbar machen, dass sie immer schon unterscheidet.
Kurzformel:
- Sprache unterscheidet → Denken folgt → Wirklichkeit erscheint.
- Deshalb kann Gleichstellung nie „fertig“ in Sprache eingelöst werden.
Sprache unterscheidet.
@sms2sms
Denken wiederholt.
Wirklichkeit gehorcht.
| Ebene | Fachbegriff (Deutsch) | Beschreibung |
|---|---|---|
| BIO | biologisches Geschlecht | Chromosomen, Hormone, anatomische Merkmale (dissent.is) |
| PSY | Geschlechtsidentität | Innere Selbstwahrnehmung („Ich bin…“) (dissent.is) |
| SOC | soziales Geschlecht (Gender) | Soziokulturelle Rollen, Erwartungen, Ausdrucksformen (dissent.is) |
Hier die Übersicht:
| Aspekt | Früher (bis ca. 20. Jh.) | Heute (21. Jh.) |
|---|---|---|
| Hauptfunktion Sex | Fortpflanzung, Erhalt der Familie | Lust, Intimität, Identität, Selbstverwirklichung |
| Normatives Modell | Ehe = Pflicht, Frau = Mutter, Mann = Versorger | Vielfalt an Lebensmodellen, Geschlechterrollen im Plural |
| Kontrolle | Kirche, Moral, Patriarchat | Medizin, Technik, Biopolitik |
| Fortpflanzung | Natürlich, „Zufall“, oft viele Kinder | Geplant, technisch unterstützt (IVF, Screening) |
| Geschlechterbild | Binär (Mann/Frau) | Spektrum (trans, non-binär, queer, intersex) |
| Bewertung „seriös“ | Sex = legitim nur zur Zeugung | Sex = legitim für Lust, Kinder = legitim via Technik |
Genau – das lässt sich so fassen:
- Biologisches Geschlecht (Sex) → bleibt zufällig, kontingent, medizinisch manipulierbar.
- Soziales Geschlecht (Genderrolle) → bleibt sprachlich, kulturell, niemals neutral.
- Geschlechtsidentität (Psy) → einzig autonom wählbar, selbstbestimmt, anschlussfähig.
Kurzformel:
- Vergangenheit: Sex bestimmt.
- Gegenwart: Rolle streitet.
- Zukunft: Identität zählt.
(…)
(…)
Alice Schwarzer vs. Esther Vilar
Hier der direkte Vergleich:
| Thema | Alice Schwarzer (geb. 1942) | Esther Vilar (geb. 1935) |
|---|---|---|
| Hauptwerk | „Der kleine Unterschied“ (1975) | „Der dressierte Mann“ (1971) |
| Grundthese | Frauen sind Opfer patriarchaler Strukturen | Männer sind Opfer weiblicher Manipulation |
| Rollenbild Frau | Unterdrückt, strukturell benachteiligt | In Wirklichkeit mächtig, nutzt Männer aus |
| Rollenbild Mann | Herrschend, privilegiert | Unterdrückt, ausgenutzt (arbeiten, versorgen) |
| Feminismus | Radikalfeministin, Gründerin der EMMA | Antifeministische Provokateurin |
| Gesellschaftliche Wirkung | Etablierung feministischer Debatte in Deutschland | Skandal, Gegenentwurf, von Feministinnen massiv kritisiert |
| Rezeption | Institution, Einfluss in Politik & Medien | Außenseiterin, lange tabuisiert, später kultig-provokant |
- Schwarzer: „Frauen sind die Unterdrückten.“
- Vilar: „Frauen sind die eigentlichen Herrscherinnen.“
(…)
(…)
Cyberweiber
| Achse | Transhumanismus (Männer) | Posthumanismus (Cyberweiber) |
|---|---|---|
| Leitidee | Optimierung, Überbietung, Unsterblichkeit | Auflösung, Relation, Symbiose |
| Sprache | Fortschritt, Kontrolle, Enhancement | Netzwerke, Care, Fluidität |
| Machtgestus | Linear, patriarchal, Herrschaft | Dezentral, relational, jenseits von Beherrschung |
| Medium | Sprache (Manifest, Theorie) | Code (Programmierung, Cyberspace) |
| Namen | Ray Kurzweil, Nick Bostrom, Elon Musk | Donna Haraway, Rosi Braidotti, Sadie Plant |
| Zukunftsbild | Der verbesserte Übermensch | Das vernetzte, posthumane Kollektiv |
Kurzformel:
- Transhumanismus → „Männer träumen vom Upgrade.“
- Posthumanismus → „Cyberweiber schreiben das Netz neu.“
Mini-Manifest in 5 Sätzen
- Die Transhumanisten träumen vom Upgrade des Menschen – stärker, klüger, unsterblich.
- Die Posthumanistinnen denken den Menschen ab – vernetzt, durchlässig, symbiotisch.
- Männer schreiben Manifeste in Sprache, Frauen hacken die Welt im Code.
- Sprache bleibt binär, Code kann plural.
- Die Zukunft gehört nicht dem Übermenschen, sondern dem vernetzten Kollektiv.
(…)
(…)
(…)
FRAUEN FÜR DEN KRIEG
(…)
(…)
(…)
QUI BONO
(…)
(…)
(…)
(…)
Nächster Titel
(…)
(…)
Nächster Titel
(…)
(…)
(…)
Nächster Titel
(…)
(…)
(…)
Nächster Titel
(…)
(…)
(…)
Nächster Titel
(…)
(…)
(…)
(…)
Nächster Titel
Nächster Titel
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
Nächster Titel
(…)
(…)
(…)
Wie ich mit den Möglichkeiten von @openAI arbeite?
Links, Threads, zu verarbeitende Hinweise…
(…)
(…)
(…)
Offene Blogeinträge, welche zu diesem Thema passen…
(…)
(…)
(…)
Textsorte: (1) Traum, (2) Blitz, (3) Bekenntnis, (4) Memo, (5) Märchen, (6) Drama, (7) Tabu
Arbeitsform: Dokumentation, Listenbildung, Work in Progress
Anlass: (…)
TL;DR: (…)
Bildquelle: (…)
URL/Hashtag: (…)

Stefan M. Seydel, aka sms, aka sms2sms in «Zürcher Festspiel 1901″ (2019, Fotocredit: Charles Schnyder): Twitter, Wikipedia (Lemma), Youtube (aktuell), Soundcloud, Mastodon, Instagram (gesperrt), Snapchat, TikTok, Twitch, t.me/WikiDienstag (Nicht in Betrieb) | Exklusiv: speakerbooking.ch/sms2sms
About @sms2sms, aka Stefan M. Seydel/sms ;-)
Stefan M. Seydel, Jahrgang 1965, ist Unternehmer, Sozialarbeiter und Künstler. Er machte nach einer Berufslehre als Hochbauzeichner einen Bachelor in Soziale Arbeit in St. Gallen und einen Master in der gleichen Disziplin bei Silvia Staub-Bernasconi in Berlin. Seine überwiegend selbstständige Tätigkeit kreist um das Thema der Entwicklung und Realisierung von Pilot- und Impulsprojekten für renommierte Auftraggeberinnen.
Als Künstler hat er Ausstellungen und Performances auf internationaler Ebene präsentiert, darunter in der Royal Academy of Arts in London, dem Deutschen Historischen Museum in Berlin oder einer Einzelausstellung “Kunst Macht Probleme” in der Crypta Cabaret Voltaire, Birthplace of DADA in Zürich. Er wurde mit dem Migros Jubilée Award in der Kategorie Wissensvermittlung ausgezeichnet und hat diverse Ehrungen durch Webby Awards für seine Arbeit mit rocketboom.com erhalten.
Stefan war Jury-Mitglied des Next Idea Prix Ars Electronica 2010 und war drei Jahre Mitglied der Schulleitung des Gymnasiums Kloster Disentis. Sein Wissen und seine Erfahrung im Bereich der Information und Technologie haben ihm auch dabei geholfen, mit Statistik Stadt Zürich und Wikimedia Schweiz unter WikiDienstag.ch zusammenzuarbeiten.
Sein Engagement im Bereich der freiwilligen Arbeit führte ihn in das Präsidium Internationaler Bodensee Club (Leitung Fachgruppe Wissenschaft) oder für einige andere Jahre als Vice-Präsident des von Paul Watzlawick initiierten P.E.N.-Club Liechtenstein. Seydel hat unter ((( rebell.tv ))) zwei Bücher zusammen mit seiner Partnerin Tina Piazzi veröffentlicht, viele Kolumnen, Fachtexte und journalistische Texte publiziert.
Seine Arbeit auf Social Media nutzt er als Microblogging. In seinem Blog verarbeitet er seine Themen. Einige davon werden auf Anfragen zu lesbaren Texten vertieft, andere werden zu Vorträgen ausgebaut. Bei Carl Auer Verlag in Heidelberg, sammelt er “Elemente einer nächsten Kulturform”. Seine Entwicklungen im Kontext der sozialräumlichen Intervention (“Arbeit am Sozialen”) machen konkrete Vorschläge in Bezug auf die Beantwortung der Sozialen Frage.
Nach 12 Jahren Berlin und 6 Jahren Zürich zog er aber in seiner zweiten Lebenshälfte vom Bodensee der Rheinquelle entgegen nach Dissentis/Mustér und hat seine Reisetätigkeit fast ganz eingestellt. Dafür macht er umsomehr sogenannte Passadis und #Feedlogs (Orgiastik). Das sind Arbeitsmeetings an intentionalen Fragen in einem Lifestream. (so?) Text supported by #TaaS

Aus Band 2 von: Tina Piazzi & Stefan M. Seydel, Junius-Verlag Hamburg | pdf: Band 1, 2009 | Band 2, 2010

#dfdu = DIE FORM DER UNRUHE | blog: dissent.is | about: dissent.is/sms | dissent.is/muster


Indizis locals tras il canal WhatsApp.
