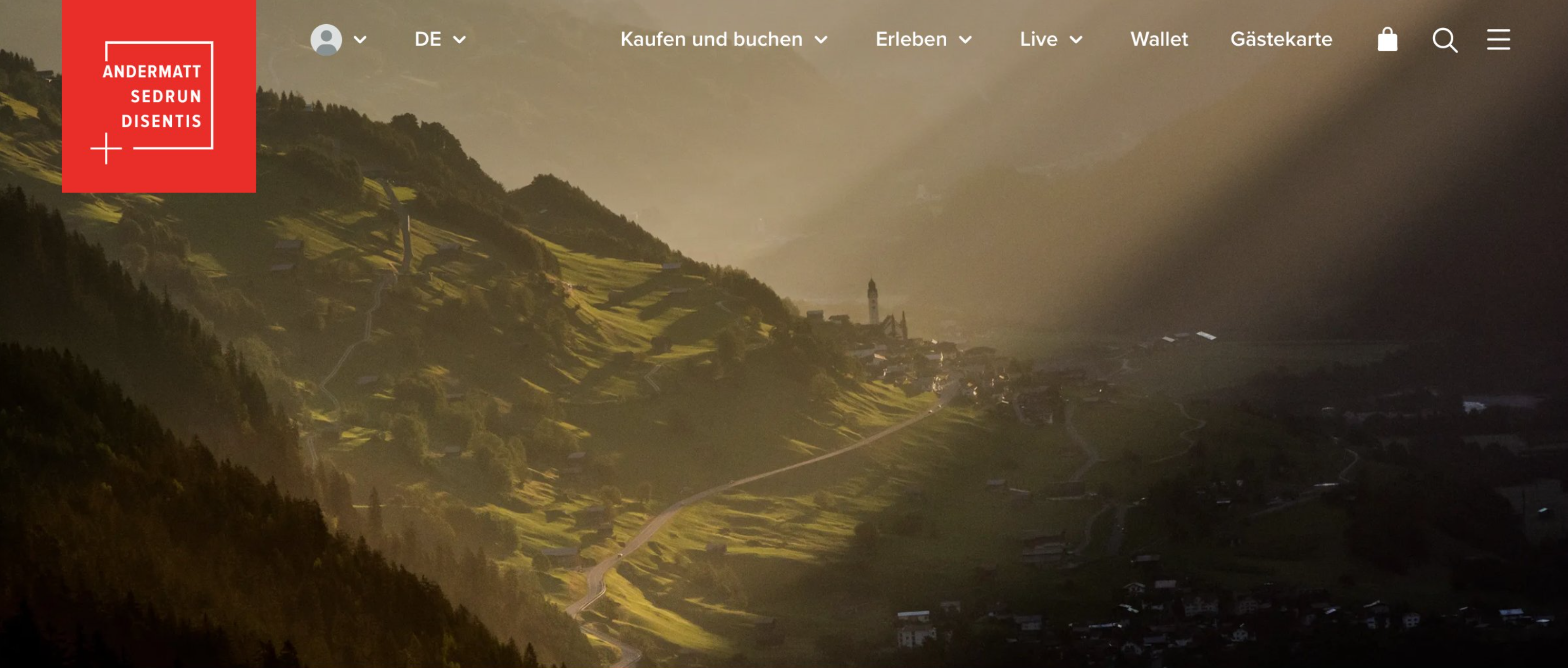wer verkauft wem wie die #surselva?
1. Historischer Rahmen
- Zeitraum: 4.–8. Jahrhundert
- Raum: Raetia (heute Graubünden, Tirol, Teile von Süddeutschland)
- Übergangszeit von römischer Provinzstruktur zur fränkisch-karolingischen Sakralordnung
2. Zentrale Merkmale der Rätischen Mission
- Frühe Christianisierung entlang der römischen Verkehrsachsen (z. B. via Claudia Augusta, Septimer, Lukmanier)
- Bischofssitz in Chur (Curia Raetorum) als kirchliches Zentrum seit spätestens 5. Jh.
- Einfluss von Mailand, später Aquileia, dann fränkisch-römische Integration ab 8. Jh.
- Adlige Eigenkirchen und Klostergründungen als Instrumente der Mission (→ Patronat)
- Synkretismus: Christliche Rituale überlagern ältere rätische, romanische oder keltische Kultpraktiken
3. Sakralandschaft (Beispiele & Typen)
| Ort / Typ | Bedeutung |
|---|---|
| Chur | Frühester Bischofssitz nördlich der Alpen |
| Müstair | Karolingisches Kloster, UNESCO-Welterbe, gegründet um 775 (Karl d. Grosse?) |
| Disentis (Mustér) | Gründung 8. Jh., Verbindung zu fränkischer Missionspolitik |
| Zillis / St. Martin | Romanische Kirchenkunst, Holzdecke 12. Jh. |
| Passlandschaften | Sakrale Wegkreuze, Kapellen entlang von Transitrouten |
| Heilige Quellen & Matronenkulte | Transformation vorchristlicher Kultorte durch Christianisierung |
4. Spezifika der rätischen Sakraltopografie
- Verschränkung von Topografie und Theologie: Kirchen auf Anhöhen, an alten Kultplätzen, bei Quellen
- Verkehrsachsen als Vektoren der Mission: Sakralbauten folgen Römerstrassen
- Dichte Mikroarchitektur: Viele kleine Kirchen, Kapellen, Wegheiligtümer
- Mehrsprachigkeit: Frühform rätoromanischer Liturgie & Bibelübersetzungen
5. Kulturelle Umcodierung
- Alte Kultorte bleiben erhalten, erhalten aber neue Narrative (z. B. Märtyrerlegenden)
- Bergheiligtümer (z. B. auf Pässe) werden zu Zeichen transalpiner Präsenz der Kirche
- Sakrallandschaft dient der Identitätsstiftung (lokal, aber auch imperial-fränkisch)