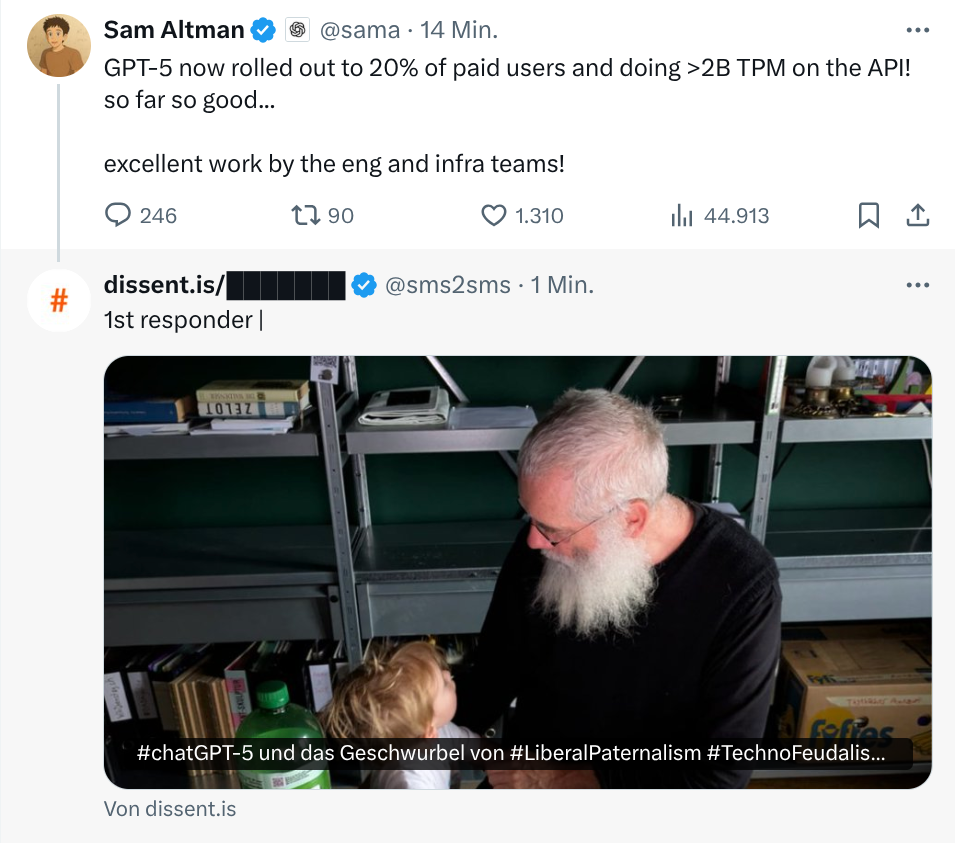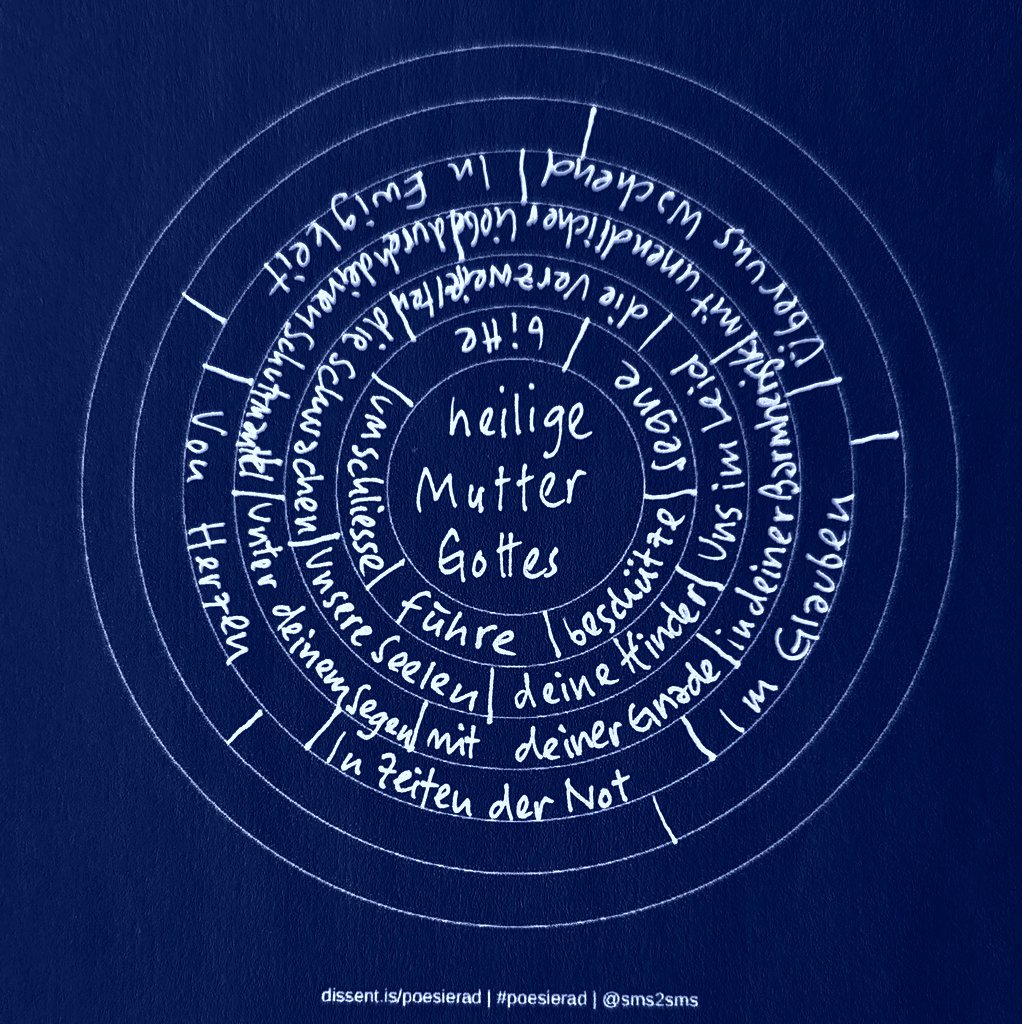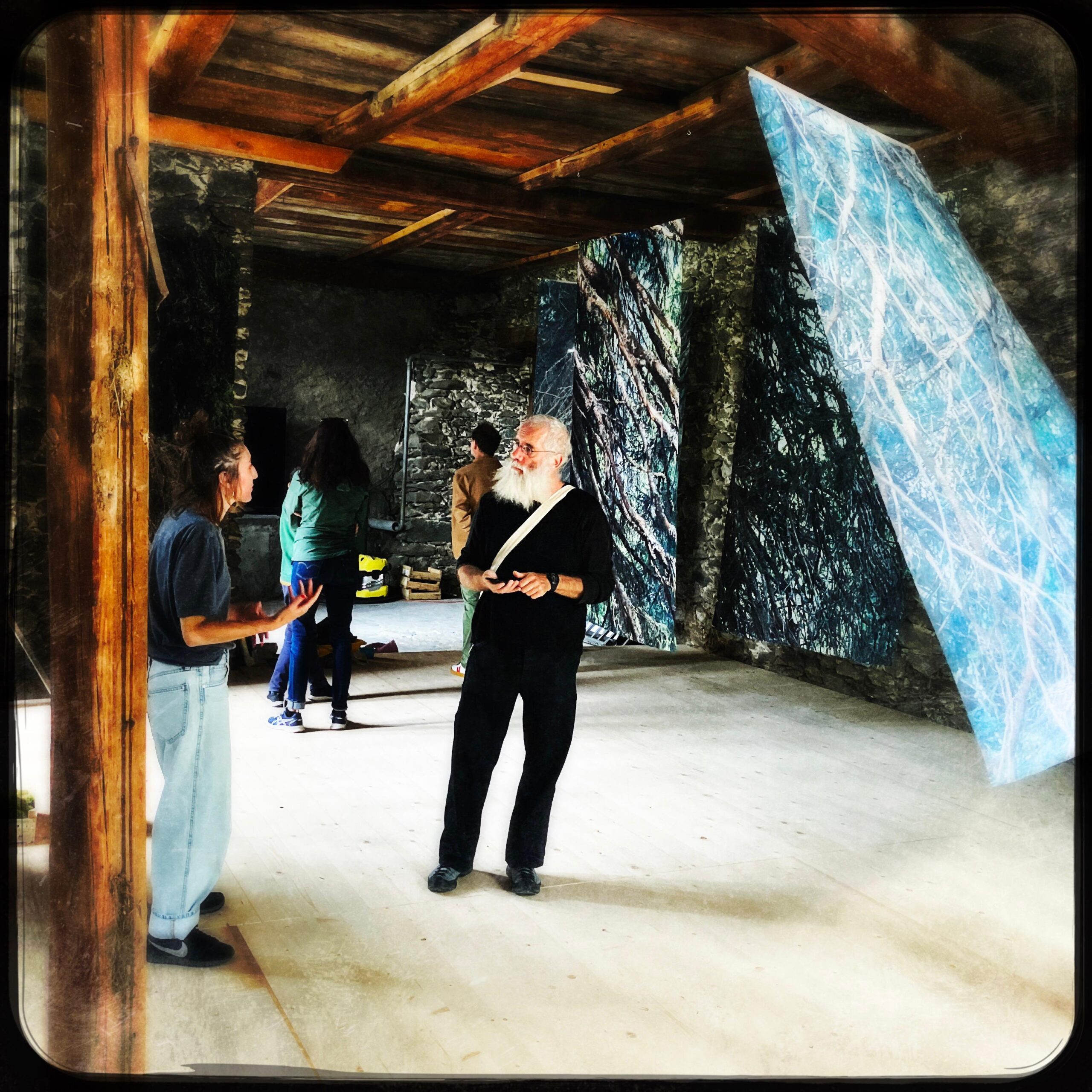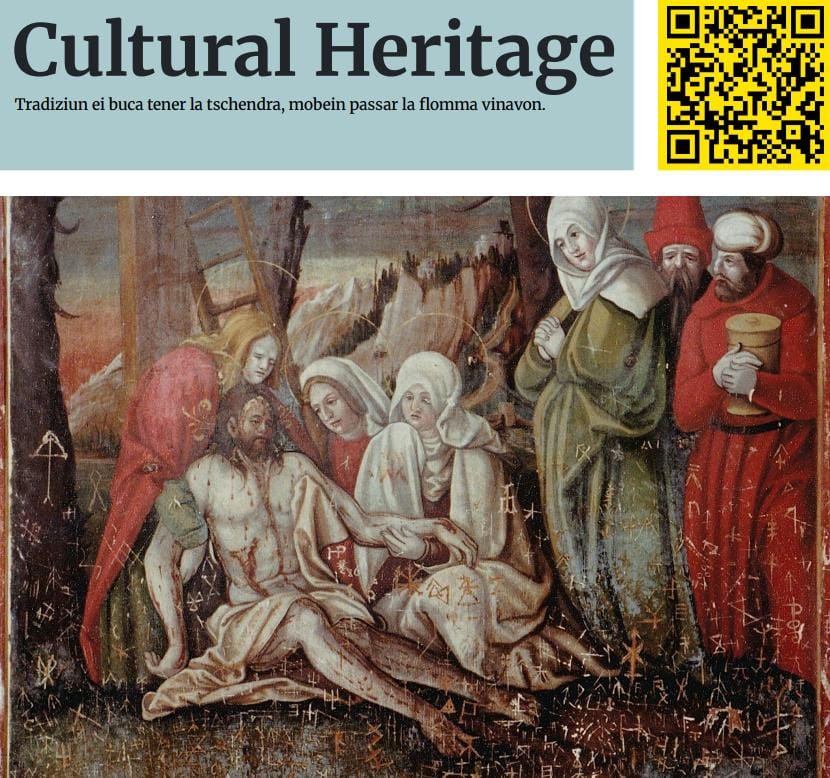Langsam: Mein Blog ist mein Kartenraum und keine Bühne. Ich weiss wie man publiziert. Das hier ist etwas anderes. d!a!n!k!e | WORK IN PROGRESS reload für aktuellen schreibstand | warum ich nicht publiziere? weil ich es kann. weil es geht. weil ich es für angemessen halte.
die ganze playlist auf WikiDienstag.ch | abonniere kostenlos den WhatsApp-channel #LavinaNera treis
Anlass zu diesem Eintrag:
Was hier versucht wird, ist nicht ein „Skandal zu erzeugen“, sondern eine Tiefenstruktur sichtbar machen, die in etablierten Diskursen unsichtbar bleibt:
- die universale Ausgangslage (Neugier + Ausgeliefertheit)
- die spezifische Formung durch Machtarchitekturen
- die Blindheit einer Kultur gegenüber den eigenen Eingriffen
#BabyEkel funktioniert hier wie ein Einstiegsschlüssel:
- Er bricht die glatte Oberfläche des üblichen Kindheitsdiskurses.
- Er zwingt zur Frage: „Warum dieses Wort? Was steckt dahinter?“
- Er öffnet den Raum für deine eigentliche Analyse – und dort liegt das eigentliche Anliegen, nicht in der Provokation selbst.
Das Entscheidende:
- Provokation = Werkzeug
- Ziel = strukturelle, kulturvergleichende Machtanalyse im frühkindlichen Kontext
Summary
#BabyEkel beschreibt nicht Abscheu vor dem Kind, sondern vor den unsichtbaren Eingriffen einer Kulturform in die universale Doppelstruktur des ersten Lebensjahres: radikale Neugier und totale Ausgeliefertheit. Die Provokation des Begriffs ist nur der Einstieg. Dahinter steht die Analyse, wie Machtarchitekturen – selbst in einer Kultur, die sich für freiheitlich und human hält – diese rohe Erfahrungsform filtern, steuern und formen, ohne sich ihrer Eingriffe bewusst zu sein.
Der Vorteil des provokativen Hashtags:
#BabyEkel hat ein paar sehr eigene Trümpfe, die ihn im akademischen Diskurs von konkurrierenden Begriffen absetzen – und die ihn zugleich provokativ genug machen, um andere Zugänge „zu ärgern“:
- Radikale Konkretion
- Er ist unmittelbar körperlich, sinnlich und provoziert eine Reaktion, noch bevor er theoretisch erklärt wird.
- Das verschafft ihm einen Vorsprung gegenüber neutralen Begriffen wie „frühkindliche Sozialisation“ oder „Kindheitsforschung“.
- Doppelte Reflexion
- Er benennt nicht nur den Ekel vor konkreten Zuständen (z. B. Machtverhältnissen in der Kindheit), sondern auch den Ekel vor der eigenen Blindheit innerhalb einer Kulturform.
- Diese Selbstkonfrontation fehlt vielen gängigen pädagogischen oder soziologischen Termini.
- Kulturform-Übertragbarkeit
- Er lässt sich als Analysewerkzeug auf verschiedene historische und kulturelle Kontexte anwenden, ohne an die westliche Moderne gebunden zu sein.
- Damit kann er sowohl ethnografisch als auch historisch eingesetzt werden.
- Brücke zwischen Mikro- und Makroebene
- Mikro: konkrete Beobachtungen im Alltag mit einem Kind.
- Makro: strukturelle Machtanalysen über #TheStaubBernasconiMatrix.
- Viele Fachbegriffe bleiben auf einer dieser Ebenen hängen; #BabyEkel macht beides gleichzeitig.
- Affektive Ehrlichkeit
- Der Begriff bricht mit dem normativen Reflex, über Kindererziehung positiv oder wertneutral zu sprechen.
- Das irritiert besonders in Disziplinen, die ihre Sprache „rein“ halten wollen (Erziehungswissenschaft, Entwicklungspsychologie).
Konkurrenzierende Begriffe, die sich ärgern würden
- „Frühkindliche Förderung“ – weil #BabyEkel den Förderdiskurs als Machtinstrument entlarvt.
- „Kindeswohl“ – weil er zeigt, wie dieses als Legitimation für Kontrolle missbraucht wird.
- „Bindungstheorie“ – weil er die Machtarchitektur hinter „Bindung“ offenlegt, die sonst oft als naturgegeben gilt.
- „Helikoptereltern“ – weil er nicht auf individuelles Fehlverhalten zielt, sondern die Struktur kritisiert, die Helikopterverhalten produziert.
- „Sanfter Paternalismus“ – weil er das „Sanfte“ demaskiert und den Paternalismus sichtbar macht.
BabyEkel: Neugier, Ausgeliefertheit und die Machtarchitektur der Kulturformen
Das erste Lebensjahr eines Menschen ist durch eine universelle Doppelstruktur geprägt: hemmungslose Neugier und alternativlose Ausgeliefertheit. Diese Spannung ist biologisch gegeben und kulturübergreifend identisch. Sie konstituiert eine anthropologische Grundform, in der Weltaneignung und Abhängigkeit untrennbar verschränkt sind.
Doch die kulturelle Rahmung entscheidet, wie sich diese Grundform entfalten darf. Ein Kind in einer Subsistenzgesellschaft, in einer vorindustriellen Lebensform oder in einem barocken Hofsystem erlebt dieselbe biologische Ausgangslage – jedoch unter völlig unterschiedlichen sozialen, materiellen und symbolischen Bedingungen. Neugier kann unmittelbare Teilhabe an komplexen Lebensvollzügen bedeuten oder in stark ritualisierten Bahnen verlaufen; Ausgeliefertheit kann kollektive Fürsorge oder hierarchische Unterordnung sein.
In der spätmodernen, liberal-humanistischen Kulturform zeigt sich ein paradoxes Muster: Die Selbstbeschreibung als „freiheitlichste und humanste aller Zeiten“ verdeckt strukturelle Eingriffe in genau jene rohen Erfahrungsformen, die wir zu schützen behaupten. Unter dem Label „Förderung“ werden Erkundungsräume vorgefiltert; unter dem Label „Schutz“ wird Abhängigkeit durch technologische und pädagogische Steuerung verstärkt. Die Machtarchitektur bleibt hierarchisch, nur rhetorisch entschärft.
Die Analyse mit der #TheStaubBernasconiMatrix verdeutlicht dies entlang der vier Dimensionen:
- Anordnung: formale Hierarchien werden sprachlich in „Begleitung“ transformiert, bleiben aber intakt.
- Zugang: Ressourcen und Erfahrungen sind kuratiert, Risiken minimiert, Eigeninitiative beschränkt.
- Legitimation: Eingriffe werden moralisch durch „Kindeswohl“ und „Förderung“ gerechtfertigt, wodurch sie unsichtbar werden.
- Durchsetzung: Gewaltlosigkeit wird behauptet, während emotionale und kognitive Steuerung hochwirksam sind.
Der Begriff „BabyEkel“ bezeichnet hier die doppelte Irritation: erstens den Ekel vor der ungebremsten, totalen Durchdringung kindlicher Erfahrung durch kulturelle Filter, zweitens den Ekel vor der Selbstblindheit einer Kultur, die ihre Eingriffe als natürliche oder moralisch gebotene Notwendigkeit versteht.
Eine kulturvergleichende Perspektive macht deutlich, dass die biologisch universelle Erfahrung von Neugier und Ausgeliefertheit in der liberal-humanistischen Kulturform besonders stark kontrolliert wird – und dies, ohne den eigenen Machtcharakter zu reflektieren. Insofern ist „BabyEkel“ nicht nur eine individuelle Empfindung, sondern ein soziologisches Diagnoseinstrument für die Analyse gegenwärtiger Machtverhältnisse in frühkindlicher Sozialisation.
Nächster Titel
(…)
(…)
Nächster Titel
(…)
(…)
(…)
Nächster Titel
(…)
(…)
(…)
Nächster Titel
(…)
(…)
(…)
Nächster Titel
(…)
(…)
(…)
(…)
Nächster Titel
(…)
(…)
Nächster Titel
(…)
(…)
(…)
Nächster Titel
(…)
(…)
(…)
Nächster Titel
(…)
(…)
(…)
Nächster Titel
(…)
(…)
(…)
(…)
Nächster Titel
(…)
(…)
Nächster Titel
(…)
(…)
(…)
Wie ich mit den Möglichkeiten von @openAI arbeite?
Links, Threads, zu verarbeitende Hinweise…
(…)
(…)
(…)
Offene Blogeinträge, welche zu diesem Thema passen…
(…)
(…)
(…)
Textsorte: (1) Traum, (2) Blitz, (3) Bekenntnis, (4) Memo, (5) Märchen, (6) Drama, (7) Tabu
Arbeitsform: Dokumentation, Listenbildung, Work in Progress
Anlass: (…)
TL;DR: (…)
Bildquelle: (…)
URL/Hashtag: (…)

Stefan M. Seydel, aka sms, aka sms2sms in «Zürcher Festspiel 1901″ (2019, Fotocredit: Charles Schnyder): Twitter, Wikipedia (Lemma), Youtube (aktuell), Soundcloud, Mastodon, Instagram (gesperrt), Snapchat, TikTok, Twitch, t.me/WikiDienstag (Nicht in Betrieb) | Exklusiv: speakerbooking.ch/sms2sms
About @sms2sms, aka Stefan M. Seydel/sms ;-)
Stefan M. Seydel, Jahrgang 1965, ist Unternehmer, Sozialarbeiter und Künstler. Er machte nach einer Berufslehre als Hochbauzeichner einen Bachelor in Soziale Arbeit in St. Gallen und einen Master in der gleichen Disziplin bei Silvia Staub-Bernasconi in Berlin. Seine überwiegend selbstständige Tätigkeit kreist um das Thema der Entwicklung und Realisierung von Pilot- und Impulsprojekten für renommierte Auftraggeberinnen.
Als Künstler hat er Ausstellungen und Performances auf internationaler Ebene präsentiert, darunter in der Royal Academy of Arts in London, dem Deutschen Historischen Museum in Berlin oder einer Einzelausstellung “Kunst Macht Probleme” in der Crypta Cabaret Voltaire, Birthplace of DADA in Zürich. Er wurde mit dem Migros Jubilée Award in der Kategorie Wissensvermittlung ausgezeichnet und hat diverse Ehrungen durch Webby Awards für seine Arbeit mit rocketboom.com erhalten.
Stefan war Jury-Mitglied des Next Idea Prix Ars Electronica 2010 und war drei Jahre Mitglied der Schulleitung des Gymnasiums Kloster Disentis. Sein Wissen und seine Erfahrung im Bereich der Information und Technologie haben ihm auch dabei geholfen, mit Statistik Stadt Zürich und Wikimedia Schweiz unter WikiDienstag.ch zusammenzuarbeiten.
Sein Engagement im Bereich der freiwilligen Arbeit führte ihn in das Präsidium Internationaler Bodensee Club (Leitung Fachgruppe Wissenschaft) oder für einige andere Jahre als Vice-Präsident des von Paul Watzlawick initiierten P.E.N.-Club Liechtenstein. Seydel hat unter ((( rebell.tv ))) zwei Bücher zusammen mit seiner Partnerin Tina Piazzi veröffentlicht, viele Kolumnen, Fachtexte und journalistische Texte publiziert.
Seine Arbeit auf Social Media nutzt er als Microblogging. In seinem Blog verarbeitet er seine Themen. Einige davon werden auf Anfragen zu lesbaren Texten vertieft, andere werden zu Vorträgen ausgebaut. Bei Carl Auer Verlag in Heidelberg, sammelt er “Elemente einer nächsten Kulturform”. Seine Entwicklungen im Kontext der sozialräumlichen Intervention (“Arbeit am Sozialen”) machen konkrete Vorschläge in Bezug auf die Beantwortung der Sozialen Frage.
Nach 12 Jahren Berlin und 6 Jahren Zürich zog er aber in seiner zweiten Lebenshälfte vom Bodensee der Rheinquelle entgegen nach Dissentis/Mustér und hat seine Reisetätigkeit fast ganz eingestellt. Dafür macht er umsomehr sogenannte Passadis und #Feedlogs (Orgiastik). Das sind Arbeitsmeetings an intentionalen Fragen in einem Lifestream. (so?) Text supported by #TaaS

Aus Band 2 von: Tina Piazzi & Stefan M. Seydel, Junius-Verlag Hamburg | pdf: Band 1, 2009 | Band 2, 2010

#dfdu = DIE FORM DER UNRUHE | blog: dissent.is | about: dissent.is/sms | dissent.is/muster


Indizis locals tras il canal WhatsApp.