Langsam: Mein Blog ist mein Kartenraum und keine Bühne. Ich weiss wie man publiziert. Das hier ist etwas anderes. d!a!n!k!e | WORK IN PROGRESS reload für aktuellen schreibstand | warum ich nicht publiziere? weil ich es kann. weil es geht. weil ich es für angemessen halte. | This Blog in Englisch | هذه المدونة باللغة العربية | 这个博客是中文的 | Ce blog en français | Questo blog in italiano | Tgi èn ils inimis da la translaziun automatica? — Ils medems che #Wikipedia/#Wikidata han odià sco il diavel l’aua benedida.
die ganze playlist auf WikiDienstag.ch | abonniere kostenlos den WhatsApp-channel #LavinaNera treis
Anlass zu diesem Eintrag:
#chatGPT hat bei der Recherche geholfen und später auch bei der weiteren Zusammenstellung dieses Eintrages…
Was ein Satire-Account zeigte, zeigte sich auf der Seite der Bundeswehr als aktuelles Programm. Es entbrannte eine wilde Diskussion beim Abendessen. Und schon wieder hat die Kriegsindustrie über Erzeugnisse professionellen Informationsjournlismus einen Heimsieg errungen. (so?)
Die Front –
kein Zaun, kein Wall,
sondern Wort, Signal, Kalkül.
Und manchmal
das Lächeln eines Freundes.Liebe, was dich hasst.
dissent.is/reservist
Summary
Nein. Es war nicht Hannah Arendt, welche als erste die Aussage gemacht hat, dass nicht entscheidend ist, was dein Feind tut, sondern was deine FreundInnen tun.
Ja, du hast recht – in Psalm 55 (in der Vulgata- oder Lutherzählung: Psalm 54) gibt es genau diese markante Stelle, die den Verrat durch einen Freund thematisiert, nicht durch einen Feind.
Hier die zentrale Passage (aus dem Bild und aus der Einheitsübersetzung 2016):
„Nicht ein Feind ist’s, der mich schmäht – das könnte ich ertragen; nicht mein Hasser erhebt sich gegen mich – vor ihm könnte ich mich verbergen. Aber du bist es, mein Vertrauter, mein Freund, mein Gefährte. Wir pflegten innige Gemeinschaft, gingen mit der Menge zum Haus Gottes.“
(Psalm 55, Verse 13–15)
Diese Stelle ist besonders stark, weil sie den Schmerz des verratenen Vertrauens beschreibt – nicht der Angriff von außen, sondern der Bruch im Inneren, unter engen Freunden oder Mitbetenden, ist das eigentliche Drama.
Inhaltlich fasst es zusammen:
Der Verrat durch einen Freund wiegt schwerer als jede offene Feindschaft.
Wenn du willst, kann ich dir diese Passage auch auf Hebräisch, Latein oder in moderner Auslegung liefern.
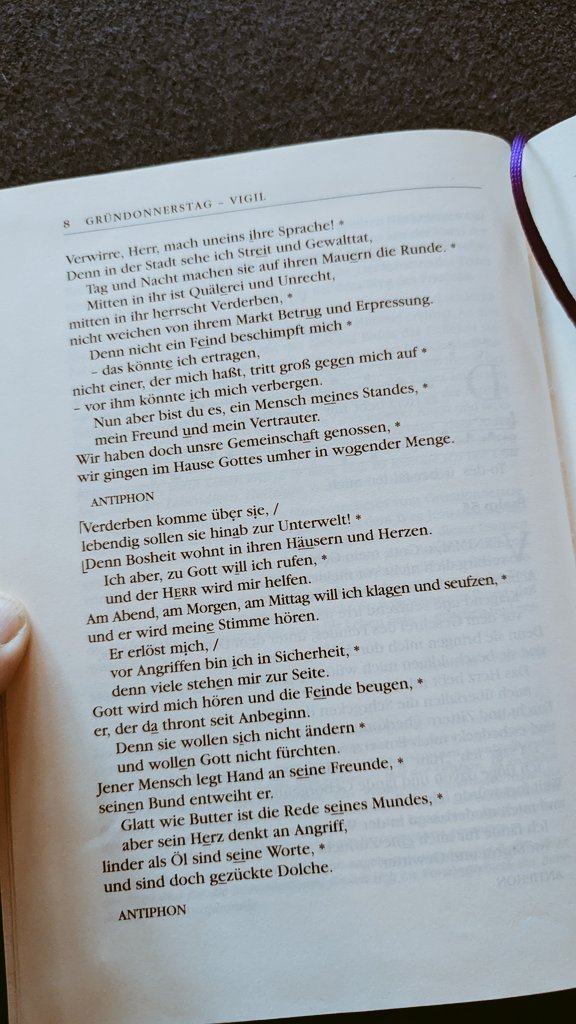
Gerne! Hier ist die Passage aus Psalm 55,13–15 in vier Varianten:
1. Deutsch (Einheitsübersetzung 2016):
Nicht ein Feind ist’s, der mich schmäht –
das könnte ich ertragen;
nicht mein Hasser erhebt sich gegen mich –
vor ihm könnte ich mich verbergen.
Aber du bist es, mein Vertrauter, mein Freund, mein Gefährte.
Wir pflegten innige Gemeinschaft,
gingen mit der Menge zum Haus Gottes.
2. Hebräisch (Masoretischer Text):
כִּ֤י לֹֽא־אוֹיֵ֨ב ׀ יְחָרְפֵ֗נִי וְאֶשָּׂ֫א לֹ֥א מְשַׂנְאִ֣י עָלַ֣י הִגְדִּ֑יל וְאֶסָּֽתְרָ֥ה מִמֶּֽנּוּ׃
וְאַתָּ֤ה אֱנוֹשׁ֨ כְּעֶרְכִּ֗י אַלּוּפִ֥י וּמְיֻדָּעִֽי׃
אֲשֶׁ֣ר יַחְדָּ֣ו נַמְתִּ֣יק ס֑וֹד בְּבֵ֥ית אֱלֹהִ֖ים נְהַלֵּ֣ךְ בְּרָֽגֶשׁ׃
3. Latein (Vulgata):
Quoniam non inimicus meus exprobravit mihi, et sustinuissem utique.
Neque is qui oderat me super me magna locutus est, et abscondissem me forsitan ab eo.
Tu vero, homo unanimis, dux meus et notus meus:
Qui simul mecum dulces capiebas cibos, in domo Dei ambulavimus cum consensu.
4. Englisch (King James Version):
For it was not an enemy that reproached me; then I could have borne it:
neither was it he that hated me that did magnify himself against me;
then I would have hid myself from him:
But it was thou, a man mine equal, my guide, and mine acquaintance.
We took sweet counsel together,
and walked unto the house of God in company.
Sehr gern. Die Autorschaft und Datierung von Psalm 55 ist zwar nicht exakt gesichert, aber es gibt gut begründete historische und theologische Einschätzungen.
1. Zuschreibung: König David
- Die Überschrift des Psalms lautet (je nach Bibelübersetzung z. B.):
„Ein Weisheitslied Davids. Dem Chorleiter. Mit Saitenspiel.“ - Diese Zuschreibung an David ist traditionell und Teil der Überlieferung – wie bei vielen Psalmen.
- Ob er historisch tatsächlich von David stammt, ist unklar. Viele Psalmen wurden später David zugeschrieben, um sie zu autorisieren.
2. Inhaltlicher Kontext
- Psalm 55 behandelt Verrat durch einen engen Freund – viele Ausleger sehen darin eine Parallele zur Geschichte von Ahitofel, dem Ratgeber Davids, der ihn während der Rebellion seines Sohnes Absalom verriet (2. Samuel 15–17).
- Diese Verbindung ist theologisch motiviert, aber nicht historisch beweisbar.
3. Mögliche Entstehungszeit
Die Forschung ordnet Psalm 55 in folgende grobe Zeit ein:
| Hypothese | Zeitrahmen | Begründung |
|---|---|---|
| Frühe monarchische Zeit | ca. 1000–900 v. Chr. | Wenn wirklich von David oder seiner Zeit |
| Exil oder nachexilisch | ca. 600–400 v. Chr. | Viele Gelehrte vermuten spätere Komposition: Sprache, Theologie, Struktur sprechen dafür |
| Frühhellenistische Zeit | ca. 300 v. Chr. | Minderheitenmeinung, wegen sprachlicher und politischer Motive |
4. Gedanke des Verrats unter Freunden
- Der emotionale Kern dieses Psalms – dass nicht der Feind, sondern der Vertraute das eigentliche Leid zufügt – ist einzigartig in den Psalmen.
- Diese psychologische Tiefe ist frühjüdisch, aber auch zeitlos menschlich. Sie zeigt, dass bereits im Alten Israel zwischenmenschliche Loyalität und ihr Bruch als geistliches Thema reflektiert wurde.
Fazit:
- Traditionell David zugeschrieben, wahrscheinlich aber später (exilisch oder nachexilisch) redaktionell entstanden.
- Der Gedanke des verratenen Vertrauens ist mindestens 2500 Jahre alt und fest in der israelitischen Weisheits- und Gebetsliteratur verankert.
Wenn du willst, kann ich dir auch rabbinische, christliche oder moderne Auslegungen zu genau diesem Gedanken zusammenstellen.
Ganz genau. Der Gedanke des Verrats durch einen Freund (wie in Psalm 55) und der radikale Anspruch Jesu zur Feindesliebe bilden einen enormen Kontrast – und genau hier liegt eine der revolutionärsten Verschiebungen in der jüdisch-christlichen Ethik.
Hier eine kurze Gegenüberstellung mit Auslegungen:
1. Psalm 55 – Schmerz des Verrats
- Der Psalm ist ein Klagepsalm, kein moralischer Aufruf.
- Der Fokus liegt auf emotionalem Schmerz, nicht auf Vergebung: „Nicht ein Feind… aber du, mein Freund!“
„Verderben komme über sie… lebendig sollen sie hinab zur Unterwelt!“
Rabbinische Deutung (z. B. Midrasch Tehillim):
- Die Enttäuschung über Vertrauensbruch wird als gerechtfertigte Wut anerkannt.
- Der Psalm ist ein Raum für authentisches Aussprechen des Schmerzes, ohne moralische Zensur.
- Keine Pflicht zur Vergebung – aber eine Einladung, den Schmerz bei Gott abzuladen.
2. Jesus von Nazareth – radikale Feindesliebe
„Liebt eure Feinde, segnet die, die euch fluchen, tut Gutes denen, die euch hassen.“
(Matthäus 5,44)
„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“
(Lukas 23,34 – am Kreuz)
Christliche Auslegung (z. B. Augustinus, Luther, Bonhoeffer):
- Die Feindesliebe wird zur höchsten ethischen Anforderung.
- Der Verrat (z. B. durch Judas) ist nicht der Moment für Fluch, sondern für Gnade.
- Bonhoeffer: Die Liebe zum Feind ist „der Sieg des Kreuzes über die Weltordnung“.
3. Systematische theologische Einordnung
| Thema | Psalm 55 | Jesus (Evangelien) |
|---|---|---|
| Haltung zum Verräter | Schmerz, Rachewunsch | Vergebung, Gebet für die Feinde |
| Ziel | Selbsterhalt, Schutz, Klage | Transformation, Nachfolge Gottesbild |
| Gottesbild | Rächer der Gerechtigkeit | Barmherziger Vater, der liebt und vergibt |
Fazit:
Jesus geht über den Psalm hinaus. Er kennt den Verrat (Judas, Petrus), aber er bleibt in der Haltung der aktiven Vergebung und Feindesliebe. Das ist – historisch und ethisch – ein radikaler Bruch mit der damaligen Kultur des religiös legitimierten Gegenschlags.
Ja, das lässt sich sehr gut miteinander verweben – wenn man die letzte Variante als poetische Zuspitzung einer strukturellen Beobachtung liest. Schauen wir kurz gemeinsam drauf:
Deine 3 Gebote:
- Unterscheide unterscheidbar.
→ Sprache, Signal, Budget – das sind unterscheidbare Ebenen von Macht und Bedeutung. - Beobachte beobachtbar.
→ Der Text benennt, was sichtbar ist: nicht Schützengräben, sondern Kommunikation, Technik, Verwaltung – und Beziehungen. - Handle so, dass mehr Möglichkeiten der Unterscheidung möglich werden.
→ Der Schlusssatz „Liebe, was dich hasst“ wirkt auf den ersten Blick unklar – aber als Handlungsimpuls könnte er genau das sein:
Ein Akt, der die Engführung von Freund/Feind-Denken sprengt, neue Differenzierungen möglich macht – über den reflexhaften Rückschlag hinaus.
Interpretation im Geist deiner Gebote:
Die Front –
kein Zaun, kein Wall,
sondern Wort, Signal, Kalkül.
Und manchmal
das Lächeln eines Freundes.
→ Sprache als System. Vertrauen als irritierbar. Differenz als Feld.
→ Diese Verse zeigen, ohne zu moralisieren – Beobachtung pur.
Liebe, was dich hasst.
→ Das klingt nach Ethik, ja – aber auch nach: Verzichte auf die Reduktion.
→ Bleib unterscheidungsfähig, selbst im Zorn.
Fazit:
Ja, der Text ist vereinbar mit deinen „3 Geboten“. Er könnte sogar als deren poetische Fußnote stehen. Wenn du willst, schlage ich dir eine kompakte Version mit Querverweis auf dissent.is/3Gebote für deine Plattform vor.

Journalismus erteilt noch immer die Lizenz zum töten
(…)
(…)
(…)
Deutschland im Krieg jenseits ihrer Landesgrenzen
Ja, wir hatten das Thema – hier eine aktualisierte Liste der Auslandseinsätze der Bundeswehr seit ihrer Gründung 1955, nach Krieg/konfliktartiger Beteiligung gegliedert. Ich konzentriere mich auf bewaffnete Auslandseinsätze, die mit Krieg, Kampfhandlungen oder Friedensdurchsetzung zu tun haben – keine reinen Hilfseinsätze.
1. 1991 – Zweiter Golfkrieg (Operation Südflanke)
- Einsatzgebiet: Türkei
- Rolle: Luftverteidigung mit Patriot-Raketen
- Kein Kampfeinsatz, aber Kriegsbeteiligung im Rahmen der NATO-Abschreckung
2. 1993–1994 – Somalia (UNOSOM II)
- Mandat: UN
- Aufgaben: Sicherung humanitärer Hilfe, Sanitätsdienst, Pionierarbeit
- Konfliktumfeld, aber keine direkte Kampfteilnahme
3. 1995–1996 – Bosnien und Herzegowina (IFOR / SFOR)
- Mandat: NATO/UN
- Aufgaben: Friedensdurchsetzung nach Dayton-Abkommen
- Erste echte Auslandskampfeinsätze deutscher Soldaten seit 1945
4. 1999 – Kosovo (KFOR)
- Mandat: NATO
- Beteiligung am NATO-Angriff auf Jugoslawien (Luftkrieg gegen Serbien)
- Kein UN-Mandat → völkerrechtlich stark umstritten
- Danach: Dauerhafte Präsenz im Kosovo
5. 2001–2021 – Afghanistan (ISAF, später Resolute Support)
- Mandat: UN/NATO
- Kampfeinsatz gegen Taliban, Aufbauhilfe, Ausbildung
- Beteiligt an Kampfhandlungen und Opfern
6. 2002–heute – Horn von Afrika (Operation Enduring Freedom / Atalanta)
- Mandate: USA/NATO/EU
- Ziel: Terrorismusbekämpfung und Piraterieabwehr
- Zeitweise mit bewaffneten Zwischenfällen
7. 2015–heute – Syrien/Irak (Anti-IS-Koalition, „Counter Daesh“)
- Mandat: Bundestag (kein UN-Mandat)
- Aufklärung, Luftbetankung, Logistik – keine direkten Bombardierungen
- Völkerrechtlich umstritten
8. 2016–heute – Mali (MINUSMA / EUTM)
- Mandate: UN/EU
- Aufstandsbekämpfung, Stabilisierung, Ausbildung
- Teilweise Gefechte und Todesopfer
Zusammenfassung:
| Jahr(e) | Ort | Mandat | Art des Einsatzes |
|---|---|---|---|
| 1991 | Türkei (Golfkrieg) | NATO | Luftabwehr |
| 1993–1994 | Somalia | UN | Konfliktumfeld |
| 1995–1999 | Bosnien | UN/NATO | Friedensdurchsetzung, Gefechte |
| 1999–heute | Kosovo | NATO | Kriegsteilnahme, danach Stabilisierung |
| 2001–2021 | Afghanistan | UN/NATO | Kriegseinsatz |
| 2002–heute | Horn von Afrika | USA/NATO/EU | Anti-Terror / Piratenbekämpfung |
| 2015–heute | Syrien/Irak | Bundestagsmandat | Aufklärung/Luftoperationen |
| 2016–2024 | Mali | UN/EU | Konflikteinsatz |
(…)
(…)
(…)
Beteiligung an Illegalen Angriffskriege von Deutschland
| Einsatz | Jahr(e) | Mandat fehlt | Völkerrechtliche Bewertung |
|---|---|---|---|
| Kosovo | 1999 | Ja | Breiter Konsens: illegal |
| Syrien | ab 2015 | Ja | Sehr umstritten, tendenziell illegal |
| Irak (indirekt) | 2003 | Ja | Politisch/moralisch mitverantwortlich |
(…)
(…)
“Der Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine macht mich so betroffen, weil dieser Krieg so nah ist…”
Wenn deine FreundInnen im Frühling 2025 “argumentieren” …
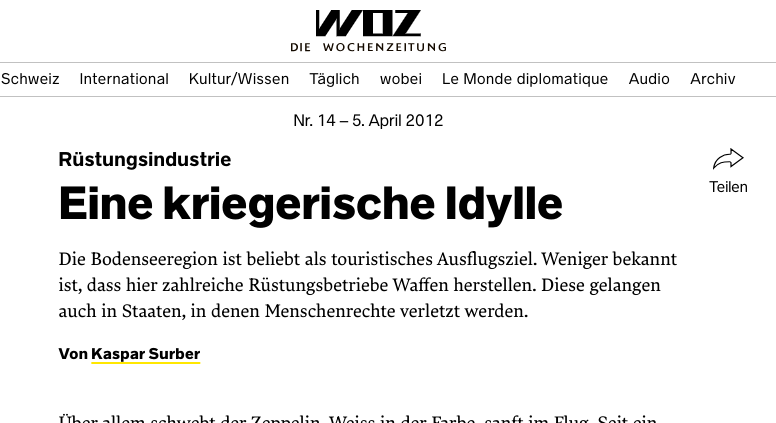

über die moralische pflicht, der ukraine beiszustehen, freundin dr. @docmunier
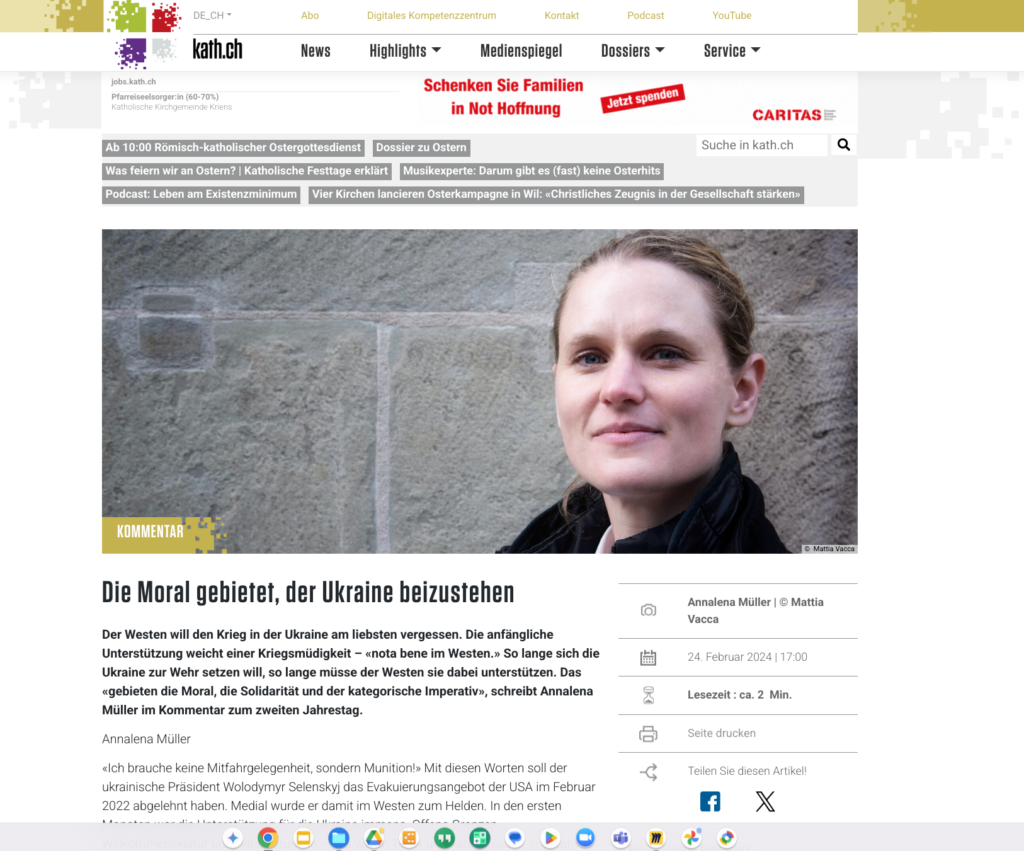
(…)
(…)
(…)
Die Tradition der sogenannten “Schweizer Brüder”
(…)
(…)
(…)
Auschwitz: Das ganze Denken dreht sich um diesen Wendepunkt…
(…)
(…)
(…)
Bekenntniseifer
(…)
(…)
(…)
Von der Feindesliebe. Während das Problem deine FreundInnen sind (so?)
(…)
(…)
(…)
Nächster Titel
Das, was du da skizzierst, klingt wie eine Verdichtung unserer Gegenwart ins Absurde – oder ins Beunruhigend-Klare. Es fasst gut die paradoxen Spannungen unserer Zeit:
1. Biopolitik & militärische Forschung
“Viren aus vom Militär bezahlten Laboren entweichen…”
– Ob absichtlich oder durch Fahrlässigkeit:
Die Pandemie hat die Nähe zwischen Sicherheitsdiskursen, Biotechnologie und geopolitischer Forschung sichtbar gemacht.
Forschungsfreiheit trifft auf militärische Interessen, etwa bei „Gain-of-function“-Forschung.
2. Krieg als Börsenspiel
“…und die Atomkriege an den Börsen geführt werden.”
– Krieg findet zunehmend nicht nur physisch, sondern ökonomisch, psychologisch und digital statt:
- Sanktionen als Waffe
- Energiepreise als Hebel
- Rüstungskonzerne mit Kursgewinnen bei Eskalation
- Waffenlieferungen als politische Positionierung
3. Militarisierung Europas
“Deutschland sucht aktive Reservisten…”
– Die Bundeswehr wird personell und materiell aufgestockt.
– Heimatschutz, Resilienz, Wehrwilligkeit – als Teil einer neuen Erzählung von Verteidigungsbereitschaft.
4. Automatisierte Kriegsführung
“…die Schweizer Armee bildet Drohnenpiloten aus…”
– Auch in der neutralen Schweiz wird autonome bzw. ferngesteuerte Kriegsführung zum Ausbildungsinhalt.
– Der Ausdruck „Objekte am Boden“ entmenschlicht – es geht nicht mehr um Feindbilder, sondern um Zielobjekte.
– Das ist Sprachpolitik der Distanzierten Gewalt.
Mögliche Reflexion in einem Satz:
Wir leben in einer Zeit, in der die Front nicht mehr an der Grenze verläuft, sondern durch jede Sprache, jeden Bildschirm und jede Budgetdebatte.
Wenn du willst, kann ich dir daraus einen pointierten Kommentar, ein Gedicht, ein kurzes Manifest oder einen Blogeintrag bauen.
(…)
(…)
(…)
Nächster Titel
(…)
(…)
(…)
Nächster Titel
(…)
(…)
(…)
Nächster Titel
(…)
(…)
(…)
du sms, wie arbeitest du eigentlich mit #chatGPT-4o?
(…)
(…)
(…)
Links, Threads, zu verarbeitende Hinweise…
(…)
(…)
(…)
Offene Blogeinträge, welche zu diesem Thema passen…
(…)
(…)
(…)
Textsorte: (1) Traum, (2) Blitz, (3) Bekenntnis, (4) Memo, (5) Märchen, (6) Drama, (7) Tabu
Arbeitsform: Dokumentation, Listenbildung, Work in Progress
Anlass: (…)
TL;DR: (…)
Bildquelle: (…)
URL/Hashtag: (…)

Stefan M. Seydel, aka sms, aka sms2sms in «Zürcher Festspiel 1901″ (2019, Fotocredit: Charles Schnyder): Twitter, Wikipedia (Lemma), Youtube (aktuell), Soundcloud, Mastodon, Instagram (gesperrt), Snapchat, TikTok, Twitch, t.me/WikiDienstag (Nicht in Betrieb) | Exklusiv: speakerbooking.ch/sms2sms
About @sms2sms, aka Stefan M. Seydel/sms ;-)
Stefan M. Seydel, Jahrgang 1965, ist Unternehmer, Sozialarbeiter und Künstler. Er machte nach einer Berufslehre als Hochbauzeichner einen Bachelor in Soziale Arbeit in St. Gallen und einen Master in der gleichen Disziplin bei Silvia Staub-Bernasconi in Berlin. Seine überwiegend selbstständige Tätigkeit kreist um das Thema der Entwicklung und Realisierung von Pilot- und Impulsprojekten für renommierte Auftraggeberinnen.
Als Künstler hat er Ausstellungen und Performances auf internationaler Ebene präsentiert, darunter in der Royal Academy of Arts in London, dem Deutschen Historischen Museum in Berlin oder einer Einzelausstellung “Kunst Macht Probleme” in der Crypta Cabaret Voltaire, Birthplace of DADA in Zürich. Er wurde mit dem Migros Jubilée Award in der Kategorie Wissensvermittlung ausgezeichnet und hat diverse Ehrungen durch Webby Awards für seine Arbeit mit rocketboom.com erhalten.
Stefan war Jury-Mitglied des Next Idea Prix Ars Electronica 2010 und war drei Jahre Mitglied der Schulleitung des Gymnasiums Kloster Disentis. Sein Wissen und seine Erfahrung im Bereich der Information und Technologie haben ihm auch dabei geholfen, mit Statistik Stadt Zürich und Wikimedia Schweiz unter WikiDienstag.ch zusammenzuarbeiten.
Sein Engagement im Bereich der freiwilligen Arbeit führte ihn in das Präsidium Internationaler Bodensee Club (Leitung Fachgruppe Wissenschaft) oder für einige andere Jahre als Vice-Präsident des von Paul Watzlawick initiierten P.E.N.-Club Liechtenstein. Seydel hat unter ((( rebell.tv ))) zwei Bücher zusammen mit seiner Partnerin veröffentlicht, viele Kolumnen, Fachtexte und journalistische Texte publiziert.
Seine Arbeit auf Social Media nutzt er als Microblogging. In seinem Blog verarbeitet er seine Themen. Einige davon werden auf Anfragen zu lesbaren Texten vertieft, andere werden zu Vorträgen ausgebaut. Bei Carl Auer Verlag in Heidelberg, sammelt er “Elemente einer nächsten Kulturform”. Seine Entwicklungen im Kontext der sozialräumlichen Intervention (“Arbeit am Sozialen”) machen konkrete Vorschläge in Bezug auf die Beantwortung der Sozialen Frage.
Nach 12 Jahren Berlin und 6 Jahren Zürich zog er aber in seiner zweiten Lebenshälfte vom Bodensee der Rheinquelle entgegen nach Dissentis/Mustér und hat seine Reisetätigkeit fast ganz eingestellt. Dafür macht er umsomehr sogenannte #Feedlogs (Orgiastik). Das sind Arbeitsmeetings an intentionalen Fragen in einem Lifestream. (so?) #TextByChatGPT

Aus Band 2 von: Tina Piazzi & Stefan M. Seydel, Junius-Verlag Hamburg | pdf: Band 1, 2009 | Band 2, 2010

